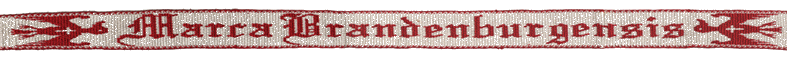
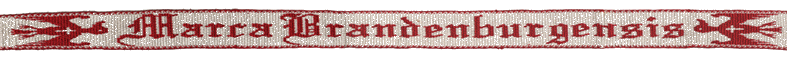
Der Sachsenspiegel
Übersicht zum rechtssystematischen Aufbau sowie vergleichende
rechtsgeschichtliche Betrachtung ausgewählter Vorschriften
Gabriela Lakatos
Stand: Januar 2007
Dies ist ein Versuch, eine Zusammenfassung des Sachsenspiegels niederzuschreiben, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau und dem Inhalt liegt. Aufgrund der Fülle von Informationen konnten viele interessante Themen nur kurz umrissen werden. Sie werden zu späteren Zeitpunkten vertieft.
Bei dem Sachsenspiegel handelt es sich um das wohl bedeutenste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters. In ihm wurde das bis dahin mündlich überlieferte Recht niedergeschrieben, das im sächsischen Gebiet gültig war. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es das Recht der Landbevolkerung (Landrecht) und das der Ritter (Lehnrecht) beinhaltet; das Recht der Städte wurde in ihm nicht erfasst. Allerdings gab es ein Wechselverhältnis, das sich z. B. in der Aufnahme einzelner Teile des Sachsenspiegels in Stadtrechten von Hamburg, Bremen und Stade zeigt. Einzelne Teile des Landrechts wurden auch für die Regelungen stadtrechtlicher Probleme herangezogen.
A Zur Entstehung
Der Sachsenspiegel ist in einer Zeit geschrieben worden, die die Geschichte der Rechtswissenschaft als das "juristische Jahrhundert" Europas beschreibt. Es handelt sich um die Zeit von 1150 bis 1250. In dieser Zeit wurden die Grundlagen der juristischen Arbeit gelegt; man spricht davon, dass das Mittelalter an eine Wende gelangt ist. Man spricht auch von einer "Wiedergeburt der Rechtskultur", indem das römische und kanonische Recht wieder aufblühten.
Nach einer früheren Auffassung wurde die deutsche Rechtsgeschichte von diesem Strom nicht erfasst, da sie das römische Recht erst seit dem 15. Jahrhundert nach Deutschland kommen sah. Nach dieser Meinung zeichnete sich die Höhe des Mittelalters dadurch aus, dass der Sachsenspiegel das bislang als Gewohnheitsrecht wirkende Recht nunmehr als germanisch-deutsches Recht zusammenfasste.
Nach einer späteren Auffassung wurde der Sachsenspiegel nicht mehr als deutsche Besonderheit betrachtet, sondern war Ausdruck dafür, dass auch Deutschland an den allgemeinen europäischen Entwicklungen teilnahm. Er ist Teil der großen Aufzeichnungen des Gewohnheitsrechts in Europa, die überall in Europa im 12. und 13. Jahrhundert entstanden sind.
Das mittelalterliche Recht kann grundsätzlich als ungeschriebenes Gewohnheitsrecht bezeichnet werden, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Das bedeutete, dass das eigentliche Recht meistens erst im Streitfall zu erkennen war, da sich erst in Konfliktfällen die gewohnheitsrechtlichen Regeln vor Gericht zeigten. Es wurde kein Anlass gesehen, die Regeln auch bei Nichtvorliegen eines Streitfalls erkennen zu lassen.
Lediglich juristische Laien übten die Rechtsprechung aus, keine ausgebildeten Juristen. Sie wandten die ihnen überlieferten Regeln an.
Aufgrund der mündlichen Überlieferung waren die Normen territoral und lokal sehr unterschiedlich. Zudem herrschte das Personalitätsprinzip, d. h. die Vorstellung, dass jemand in eine Rechtsordnung hineinwächst und diese Rechtsnorm der Person unabhängig von dessen Aufenthaltsort anhaftete.
An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass es auch Ausnahmen gab: Bereits in den Germanenreichen entstanden an der Wende von der Antike zum Mittelalter Rechtsaufzeichnungen, die jedoch nur kurze Regelungen für bestimmte Bereiche des rechtlichen Zusammenlebens enthielten. Seit der Antike gab es schriftliche Aufzeichnungen über rechtserhebliche Tatsachen in Form von Urkunden. Im Hochmittelalter wurden mit dem Reichs-/Landfrieden Regeln auf Reichs- und Landschaftsebene herausgebildet. Die Texte wurden von Adligen beschworen, so dass es sich wohl eher um Vereinbarungen als um Gesetze gehandelt hat. Die Masse der geltenden Normen blieb jedoch Gewohnheitsrecht.
Typisch an der mittelalterlichen Rechtsordnung war die ungleiche Stellung verschiedener sozialer Gruppen. Eine Unterscheidung wurde zwischen geistlichen und weltlichen Personen gezogen. Weiter wurden z. B. Bauern und Adlige unterschieden; auch für die Dienstleute der Adligen galten andere Normen. Kurzum ist die mittelalterliche Rechtsordnung gekennzeichnet durch Mündlichkeit, eine Heterogenität und Ungleichheit hinsichtlich des räumlichen und personellen Geltungsbereichs.
Seit dem 12. Jahrhundert griff langsam eine Veränderung ein, indem das römische Recht, das mit diesem eng verwandte Kirchenrecht (kanonisches Recht) und das langobardische Lehnrecht aus Oberitalien an Einfluß gewannen. Sie drangen langsam in die mittelalterliche Rechtsordnung Europas ein (sog. Rezeption der fremden Rechte); es war ein intensives Studium vorausgesetzt, um das Recht anwenden zu können. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese "fremden Rechte" einen erheblichen Anstoß für die Aufzeichnung des heimischen Rechts gaben und somit auch maßgeblich für die Abfassung des Sachsenspiegels verantwortlich waren.
Als ein Ausgangspunkt für die Rezeption des römischen Rechts in Deutschland kann die Zersplitterung des deutschen Rechts angesehen werden und die Tatsache, dass es nicht aufgezeichet war. Die nunmehr jedoch folgenden Aufzeichnungen, so wie der Sachsenspiegel, können einerseits als Abwehrreaktionen gegen das eindringende ius utrumque angesehen werden, zeigen jedoch gleichzeitig, dass römisches Recht bereits bekannt war und in der Praxis immer bedeutungsvoller wurde.
Als Verfasser des Sachsenspiegels sieht man Eike von Repgow an. Es ist davon auszugehen, dass Eike von Repgow einer Bitte des Grafen Hoyer von Falkenstein nachkam und auf dessen Bitte die ursprüngliche Fassung ins Deutsche übersetzt hat. Dies geschah ungefähr um 1230. Die lateinische Urfassung, von der angenommen wird, dass es sie gab, ist verlorengegangen.
Ausführungen zur Person des Eike von Repgow müssen einem eigenen Aufsatz vorbehalten bleiben.
Eike von Repgow gab dem Rechtsbuch den Namen Sachsenspiegel, wodurch er zum Ausdruck gebracht hat, dass er das vorgefundene Recht seiner Heimat spiegeln, d. h. beschreiben wollte. Es sollten keine neuen Rechtsregeln geschaffen oder alte verändert werden; es sollte nur der Zustand des geltenden Gewohnheitsrechts wiedergegeben werden. Die Rechtsaufzeichnung ist eine private, die niemals ausdrücklich als geltendes Recht in Kraft gesetzt wurde. Sie erlangte jedoch im Rahmen der Rechtsanwendung durch die Gerichte, Herrschaftsträger und die bäuerliche Bevölkerung große Autorität.
So breitete sich der Sachsenspiegel schnell aus, von den Niederlanden bis in das Baltikum. Weiter gefördert wurde die Verbreitung besonders im Magdeburger Stadtrecht durch Städtegründungen bei der Ostkolonialisierung, die bis in den osteuropäischen Raum reichte. Der Sachsenspiegel wurde auch bald Vorbild für weitere Rechtsbücher, wie z. B. den Augsburger Sachsenspiegel, den Deutschenspiegel und den Schwabenspiegel. In Preußen fand er Anwendung bis zum Erlaß des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten (1794); in Sachsen war er bis zum Erscheinen des Sächsischen Bürgerlichen Gesetzbuchs im Jahr 1865 geltendes Recht. In Anhalt und Thüringen fanden einige Bestimmungen des Sachsenspiegels noch bis zur Einführung des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) im Jahre 1900 Anwendung. Sogar noch im 20. Jahrhundert wurde er 1932 von dem Reichsgericht Leipzig zitiert. Im deutschen Recht sind daher viele Rechtsgedanken auf den Sachsenspiegel zurückzuführen.
Die ursprüngliche Fassung des Sachsenspiegels hat erst im Laufe von zwei Jahrhunderten die heute bekannte Form erhalten. Der Text ist mehrfach geändert worden. Dies läßt sich aus den verschiedenen Handschriften erkennen. Es sind ca. 460 nachgewiesene Handschriften miteinander verglichen worden.
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Sachsenspiegel um eine private Rechtsaufzeichnung. Damit einher ging jedoch das Problem der Fortgeltung des Sachsenspiegels im Zusammenhang mit anderen Rechten, welche damals in Deutschland galten. Es handelte sich dabei um heimische Gewohnheitsrechte, die in Rechtsbüchern schriftlich fixiert wurden sowie um das bereits erwähnte kanonische und römische Recht.
Die Kirche besaß eigene Gerichte, die neben die weltlichen Gerichte traten. Sie waren den weltlichen Gerichten durch ihre Besetzung sowie dadurch überlegen, dass sie ein schriftlich fixiertes einheitliches Recht anwandten. Es war nicht vorgesehen, sich auf privat aufgeschriebenes Gewohnheitsrecht zu berufen, so wie es gerade im Sachsenspiegel vorlag.
Daher begann man in Deutschland, die alten einheimischen Rechtsaufzeichnungen zu bearbeiten und verfolgte das Ziel, diese mit dem kanonischen und römischen Recht in Einklang zu bringen. Dies geschah praktisch dadurch, daß man die Rechtsaufzeichnungen mit Randbemerkungen versah, in denen dann Begriffe erklärt und Parallelstellen zu den Quellen des römischen und kanonischen Rechts aufgezeigt wurden. Diese Art der Bearbeitung wurde als Glosse bezeichnet (Glossa = Erläuterung; Kommentierung, Begriffsbestimmung).
Zunächst wurde diese Methode an den Universitäten Oberitaliens entwickelt. Einer der führenden Namen der Glossatoren für das Landrecht des Sachenspiegels ist Johann von Buch (geb. ca. 1290, gest. ca. 1356, gelehrter Jurist und markgräflich-brandenburgischer Hofrichter).
B Aufbau und Inhalt
Kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern dieses Aufsatzes, der sich vornehmlich mit dem Aufbau und dem Inhalt des Sachsenspiegels beschäftigt.
Das Buch ist in zwei Hauptteile gegliedert, nämlich das Land- und das Lehnrecht. Beiden Hauptteilen sind eine Vorrede in Strophen und in Reimpaaren, ein Prolog und eine Vorrede vorangestellt. Dabei stammen nur der zweite Teil der Vorrede in Reimpaaren und der Prolog von Eike von Repgow. Die weiteren Vorreden kamen später hinzu.
In den Vorreden in Strophen werden diejenigen angesprochen, die die Lehre nicht verstehen mit der Bitte, ihr zu widersprechen, wenn kein Einverständnis besteht. In den Vorreden in Reimpaaren werden Überlegungen zur Gerechtigkeit sowie die verwerflichen Verlockungen angesprochen, das Recht zu missbrauchen. Ebenso werden die Gründe für die Verfassung des Werkes angeführt. Im Prolog ergeht die Aufforderung, die Gerichtsgewalt nach Gottes Willen zu gebrauchen und gewissenhafte Entscheidungen zu treffen.
Nach den Vorreden und dem Prolog folgen die eigentlichen Vorschriften des Sachsenspiegels. Dabei macht das Landrecht den Beginn. Es ist grob in drei Bücher gegliedert; der Inhalt läßt jedoch eine differenziertere Gliederung zu. Wendet man die moderne Terminologie an, behandelt das Landrecht folgende Rechtsbereiche:
Familien-und Erbrecht, Strafrecht, Verfassungsrecht, Gerichtsverfassungsrecht, Verfahrensrecht sowie Dorf- und Nachbarrecht. Das Lehnrecht enthält die Normen, die zwischen den Lehnsherren und den Vasallen gelten.
Dieser Aufsatz betrachtet zunächst nur das Landrecht.
1. Familien- und Erbrecht
Nachstehend wird eine Auswahl von interessanten Regeln wiedergegeben:
Das Familien- und Erbrecht ist geprägt durch die Großfamilie (Sippe). Erbrechtlich bestand die Regelung, daß das Eigen (Eigentum, Grundbesitz) des Verstorbenen zunächst an seine Kinder fiel, wobei die Söhne den Töchtern vorgingen. Sofern ein Sohn bereits vor dem Erblasser verstorben war, erbten dessen Söhne. Danach erbten die Eltern, dann die Geschwister und danach die weiteren Verwandten. Gleichnahe Erben erbten zu gleichen Teilen. Der Älteste sollte teilen, der Jüngste wählen.
Folgendes ist besonders interessant an dem Erbrecht des Mittelalters:
"Ldr. I, 6, § 2: Wer das Erbe nimmt, der soll nach Recht die Schuld zahlen, soweit wie das Erbe gewährt an fahrender Habe." Auch heute noch gilt der Grundsatz, daß mit dem Erbe die Schulden übergehen. Daran hat sich nichts geändert.
Bevor ich weiter auf die verschiedenen Erbfolgen eingehe, komme ich auf ein weiteres zentrales Element des Familienrechts, nämlich das der Ehe, damit die mit dem Tod eines Ehepartners verbundenen erbrechtlichen Fragen besser zu verstehen sind.
Die reguläre Ehe war die Sippenvertragsehe oder auch Muntehe. Der Brautvater übergab dem Ehemann die Gewalt über seine Tochter (Munt). Der Ehemann übergab der Familie der Braut ein gewisses Vermögen (Vermögenszuwendung); die Braut brachte eine Mitgift (Aussteuer) mit. Diese stellte zugleich eine Abfindung des Erbanspruchs der Frau auf das väterliche Vermögen dar.
Die volle Rechtswirkung der Ehe trat nach dem Geschlechtsakt ein, wodurch die nicht vorhandene Schriftlichkeit des Rechtslebens ersetzt werden sollte. Nach der Hochzeitsnacht erhielt die Braut von dem Bräutigam die Morgengabe, die eine Form der Witwenversorgung darstellt. Bei dem Tod des Ehemannes fiel die Morgengabe der Witwe zu. Bei der ritterlichen Frau handelte es sich um einen Knecht/eine Magd sowie Vieh. Die Morgengabe wurde von den Erben des Verstorbenen an die Frau ausbezahlt oder ihr zu lebenslangem Nießbrauch überlassen (sog. Leibgedinge).
Die verschiedenen Güter der Ehegatten blieben getrennte Vermögenmassen, was sich bei dem Tod eines Ehegatten zeigte; die Eheleute hatten jedoch kein verschiedenes Gut zu ihren Lebzeiten (Ldr. I, 31, § 1). Es bestand eine Verwaltungsgemeinschaft hinsichtlich des Vermögens, wobei der Ehemann jedoch ein unbeschränktes Nutzungsrecht (= Vermögensvormundschaft) über das gesamte Vermögen hatte.
Beim Tod eines Ehepartners fielen die Gütermassen wieder auseinander mit folgenden erbrechtlichen Folgen:
- Eigen (s. o.) wurde an die jeweils nächsten Nachkommen vererbt (s. o).
Anderes konnte nur an männliche oder weibliche Nachkommen vererbt werden:
- Heergeräte, d. h. Gegenstände, die zur Kriegsausrüstung dienten (z. B. Pferd mit Sattel, Schwert, Rüstung, Bettzeug, Tischlaken, zwei Waschschüsseln, ein Handtuch) wurde nur an männliche Nachkommen vererbt.
- Gerade (Dinge für den fraulichen Gebrauch, z. B. Schafe, Gänse, Bettzeug, Garn, Leinen Frauenkleidung, Schmuck, Sesseln, Truhen...) wurde nur an die Witwe und bei dessen Tod an weibliche Erbberechtigte weiteregegeben.
Erbrechtlich standen der Frau nach dem Sachsenspiegel die Vorratshäfte, die Aussteuer und die Morgengabe zu. Sofern die Frau vor dem Mann gestorben ist, fiel die Aussteuer wieder an ihre Familie zurück, es sei denn, es waren erbbrechtigte Kinder vorhanden.
Die Frau hatte dem Mann gehorsam zu sein; er durfte sie züchtigen. Sie war bei der Betätigung von Rechtsgeschäften auf ihren Ehemann angewiesen, da sie unter seiner Vormundschaft stand.
Der Sachsenspiegel befasst sich des weiteren mit anderen Formen der Ehe, nämlich der sog. Kebsehe und der Friedelehe. Bei der ersteren handelt es sich um die Geschlechtsgemeinschaft des Herrn mit einer standesniederen Frau. Bei der zweiten um eine solche, die durch Handlungen in der Öffentlichkeit geschlossen wurde, während die Familien der Brautleute daran unbeteiligt waren. Der Sachsenspiegel enthält diese unterschiedlichen Eheformen mit den daraus resultierenden Fragen hinsichtlich der Auswirkungen auf Stand und Kinder.
Er enthält weitere sehr interessante Normen, die zu kommentieren den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen würde. Ich möchte jedoch nicht darauf verzichten, noch wenigstens eine Norm anzusprechen, nämlich Ldr. I 22, § 2, die wie folgt lautet:
"Von dem Erbe soll man an erster Stelle dem Gesinde seinen verdienten Lohn bezahlen, so wie es ihm am Tage, an dem ihr Herr starb, zustand. Und man soll sie bis zum Dreißigsten behalten, damit sie sich anderweitig verdingen können."
Dies erschien mir deshalb so interessant, da § 1969 BGB wie folgt lautet:
"Der Erbe ist verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die zur Zeit des Todes des Erblassers zu dessen Hausstand gehörten und von ihm Unterhalt bezogen haben, in den ersten 30 Tagen nach dem Eintritt des Erbfalls in denselben Umfang, wie der Erblasser es getan hat, Unterhalt zu gewähren und die Benutzung der Wohnung und der Haushaltsgegenstände zu gestatten".
Dies stellt nur ein kleines Beispiel für die große einschneidene Bedeutung des Sachsenspiegels in der Rechtsgeschichte und dessen Auswirkungen für die weitere Rechtsentwicklung dar.
2. Verfassungsrecht
Ein weiterer interessanter Komplex des Sachsenspiegels war das Verfassungsrecht, wie man es heute bezeichnen würde. Dabei ist m. E. besonders das Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Macht hervorzuheben, da dies ein zentrales Thema der mittelalterlichen Verfassung darstellt.
Nach der Zweischwerterlehre gibt es zwei Gewalten auf der Erde, nämlich die weltliche und geistliche Macht. Eike von Repgow geht von einem göttlichen Auftrag aus, der darin liegen sollte, die Christenheit gegen ihre äußeren und inneren Feinde zu beschützen. Er sah aus der Zweischwerterlehre heraus die Verpflichtung der weltlichen und geistlichen Macht, sich bei dieser Aufgabe gegenseitig zu unterstützen. Eike von Repgow ist für die Gleichrangigkeit beider Gewalten eingetreten und macht dies gleich zu Beginn des Landrechts deutlich, indem er darstellt, Gott habe dem Papst und dem Kaiser jeweils ein Schwert überlassen, wodurch ihre Kompetenzen verkörpert werden sollten. Dadurch, dass der Kaiser dem Papst jedoch den Steigbügel halten soll (Ldr. I, 1), wird davon ausgegangen, dass dem Papst letztlich doch ein gewisses kleines Vorrecht gegenüber der weltlichen Reichsgewalt zustehen sollte.
Die römische Kirche vertrat die Auffassung, der deutsche König habe Anspruch auf die Kaiserwürde. Er erhalte damit die Qualifikation zum weltlichen Schutzherrn der Kirche.
Der König wurde in sein Amt gewählt. Eike von Repgow vertrat die Aufassung, jeder deutsche Mann könne König werden, was jedoch unrealistisch war. Vorausgegangen war dem, dass zuvor das germanische Erbrechtsdenken Auswirkungen auf die Bestimmung des Königs hatte, d. h., dass derjenige Bewerber, der dem vorangegangenen König sippenmäßig am nächsten stand, die größten Chancen auf die Nachfolge hatte. Später setzte sich dann die freie Wahl durch, die völlig in die Hände der Kurfürsten gelegt wurde.
Der Sachsenspiegel enthält genaue Vorschriften bezüglich des Wahlganges:
In einem ersten Akt sollte die Person des Königs festgestellt werden. Dies bezeichnet man als irweln. Das war Sache der Reichsfürsten. In einem zweiten Akt, der Kur, wurde der König feierlich ausgerufen. Dieses Recht stand (nach Eike von Repgow!) drei geistlichen und drei weltlichen Fürsten zu, nämlich den Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier sowie dem Pfalzgraf bei Rhein, dem Herzog von Sachsen und dem Markgrafen von Brandenburg. Eike von Repgow schloss den König von Böhmen aus, was jedoch nicht der Realität entsprach.
Noch im 13. Jahrhundert ging die Entwicklung beginnend bei den Inhabern des Erstkurrechts hin zum Gremium der Alleinwähler des deutschen Königs (= Kurfürstenkollegium). Nach dem Recht der Erstwähler stand es diesen zu, dem Papst gegenüber die Wahl zu bezeugen; in der Realität hat der Gewählte dies selbst getan. Die Krönung und Salbung durch den Papst machten den König zum Kaiser.
Nach der Wahl sollte der König dem Reich huldigen und schwören, das Recht zu wahren und zu stärken. Er war nunmehr oberster Richter; wohin er kam, fiel ihm das Richteramt zu. Er konnte die Gerichtsgewalt nach unten verleihen; er war jedoch selbst an das Recht gebunden.
Die Person des Königs genoss besonderen Schutz. So konnte niemand sein Leben fordern, solange ihm das Reich nicht aberkannt war. Nach der Salbung durch den Papst und der Krönung durfte niemand den König in den Bann tun, auch nicht der Papst. Es gab jedoch Ausnahmen, die ich sehr interessant finde:
Der Kaiser zweifelt am rechten Glauben, verläßt seine eheliche Frau oder zerstört eine Kirche.
3. Gerichtsverfassung
Der nächste Komplex kann vielleicht am sinnvollsten als Gerichtsverfassung bezeichnet werden. Er nähert sich nunmehr meinem "Lieblingsthema", dem Gerichtsverfahren, insbes. dem Strafverfahren; aber dazu erst im nächsten Punkt.
Wie bereits unter Pkt. II beschrieben, war der König der höchste Richter des Reiches. Er übte seine Gerichtsbarkeit überall dort aus, wo er sich befand. Vom König wurde sämtliche Gerichtsbarkeit abgeleitet. Nur der Markgraf konnte aus eigener Macht heraus Gericht abhalten, was sich aus Ldr. III, 65, § 1 des Sachsenspiegels ergibt. Der König verlieh die Gerichtsbarkeit (Bannleihe). Um die Gerichtsbarkeit überall im Land ausüben zu können, verlieh er den Fürsten das Grafenamt, so jedenfalls der Sachsenspiegel. Hier wird es nun etwas problematisch, da die Bestimmungen des Sachsenspiegels in diesem Bereich zum Teil von der Wirklichkeit abweichen und eher vielleicht Idealvorstellungen darstellen. Tatsächlich lagen seit 1220 (1220 - 1232) Fürstengesetze vor, nach denen diejenigen Rechte erhalten haben, die auch in die Gerichtsbarkeit fallen.
Nochmals zu betonen ist im Rahmen der Gerichtsverfassung auch die Parallelität von weltlicher und geistlicher Gerichtsbarkeit. So wird im Sachsenspiegel (Ldr. I, 2, § 1) die Pflicht jedes Christen benannt, dreimal jährlich das kirchliche Gericht (Sendgericht) zu besuchen. Dabei wurde eine Unterscheidung der Stände vorgenommen:
So mußten die Schöffenbarfreien (waren zum Schöffenamt (s. u.) qualifiziert, sie hatten freien Grundbesitz und konnten unter bestimmten Bedingungen auch Ministeriale sein; ihnen kommt der fünfte Heerschild zu) den bischöflichen Send besuchen. Bauern, die im Besitz von Grund und Boden waren und dafür Zinszahlungen zu erbringen hatten, hatten den Send des jeweiligen Domprobstes aufzusuchen und die Landsassen, die keinen Landbesitz hatten, mußten zu dem Send ihres Erzpriesters gehen.
Auch die weltlichen Gerichte unterteilten nach Ständen:
Die Schöffenbarfreien mußten das Grafending aufsuchen. Dieses trat alle 18 Wochen unter Königsbann zusammen. Die Zinspflichtigen hatten alle sechs Wochen zu dem Schultheißending zu gehen und die Landsassen hatten das Gericht des Gaugrafen aufzusuchen.
Das Nichterscheinen bei Gericht hatte Sanktionen zur Folge. Die Gerichtsbarkeit des Mittelalters beschränkte sich nicht auf die Rechtsprechung in gerichtlichen Verfahren, sondern beinhaltete auch die vorbeugende Sorge für die öffentliche Sicherheit, den Landfrieden (dazu später mehr). Dazu gehörte auch die allgemeine Anordnungsbefugnis hinsichtlich der Angelegenheiten im Gemeinschaftsleben sowie das öffentliche Beurkundungswesen.
Zuletzt soll die genossenschaftliche Gerichtsbarkeit der Dorfgemeinschaft genannt werden, die eine große Bedeutung hatte. Die Dorfgenossen traten zu bestimmten Zeiten (meistens auf dem Dorfplatz) zusammen; den Vorsitz übte der Bauermeister aus.
Die Richter waren berechtigt, an jedem Ort ihres Gerichtsbezirks ein Gericht abzuhalten. Nur Klagen um Grundeigentum und Verbrechen eines Schöffenbarfreien wurden auf der rechtmäßigen Dingstätte verhandelt.
Gericht wurde meist an Hügeln in der Landschaft oder auf Plätzen vor Kirchen, Brücken und Burgtoren abgehalten. Bis in die Neuzeit wurde das Gericht unter freiem Himmel abgehalten. Einen Übergangsbau zum Gerichtsbau stellten die Gerichtslauben dar, die nach allen vier Seiten hin offen waren.
Das Gerichtspersonal bestand aus dem (Land-)Richter, den Schöffen und dem Fronboten. Dabei ist hervorzuheben, dass dass Gerichtsverfahren noch von der germanischen Trennung zwischen Richter und Urteiler ausging. So fanden die Schöffen das Urteil und teilten es dann dem Richter mit, der es dann verkündete. (Heute habe ich eher den Eindruck, die Schöffen werden vom Richter zwar notgedrungen "geduldet", aber letzten Endes nicht wirklich ernst genommen - jedenfalls in unserem deutschen Recht -, aber letztlich wird immer die jeweilige Persönlichkeit des Richters und der Schöffen ausschlaggebend sein).
Der Fronbote diente als Gerichtsdiener und Vollstrecker des Urteils, der die Parteien lädt und für den Gerichtsfrieden sorgt. Er wird von dem Richter und den Schöffen auf Lebenszeit gewählt und stammt aus dem Stand der Pfleghaften.
Das Gerichtspersonal musste bestimmte Qualifikationen vorweisen: So durfte der Richter nicht mit den Parteien verwandt sein (so auch heute), nicht in Acht und Bann stehen (dazu später mehr), nicht strafrechtlich verurteilt sein. Er durfte auch nicht taub, blind, stumm, "unsinnig" oder seiner "notdürftigen Glieder mangelhaft" sein. Die Richter wurden belehnt oder gewählt.
Die Schöffen mußten aus der Gerichtsgemeinde stammen und über Lebenserfahrung (wünscht man sich heute manchmal auch von Richtern) und Grundbesitztümer verfügen. Sie mussten zudem Ansehen genießen. Wie bereits oben erwähnt, handelte es sich jedoch um juristische Laien; erst durch die Rezeption fremder Rechte wurden sie langsam von ausgebildeten Juristen verdrängt.
Die Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels kannte keinen Instanzenzug. Die Kritik am gefundenen Urteil konnte auf zwei verschiedene Weisen vorgebracht werden. Zum einen fragte der Richter die im Gericht versammelten Personen, ob sie das von den Schöffen gefundene Urteil für rechtmäßig halten. Sofern dies der Fall war, gebot der Richter, das Urteil zu erfüllen. Hat jemand die Vulbort versagt, d. h. ist dem Urteil nicht gefolgt worden, muss auf Geheiß des Richters ein neues Urteil gefunden werden, über das dann die Mehrheit entscheidet.
Eine andere Form der Kritik war die Urteilsschelte, die zu einem höheren Richter führen sollte. Sie hat neben der Ablehnung zugleich einen beleidigenden Vorwurf gegen den Urteilsfinder enthalten, dieser habe ein unrechtes Urteil gefunden. Der Urteilsschelter mußte dem Schöffen ebenbürtig sein und seine Schelte stehend vortragen. Es ist jedoch immer noch unklar, wie dieses Rechtsmittel nun im Einzelnen tatsächlich ablief.
4. Strafrecht und Strafverfahren
Kommen wir nun zu meinem eigentlichen Lieblingsthema, dem Strafrecht und Strafverfahren, wobei es eine deutliche Differenzierung zwischen Straf- und Zivilverfahren so noch nicht gab, aber dazu im einzelnen später mehr.
Vielleicht sollte man wie folgt beginnen:
Ein Verfahren (ohne weitere Differenzierung) wurde nicht von Amts wegen eröffnet. Vielmehr lag ihm der Grundsatz zugrunde, dass die Verfolgung von Delikten Privatsache war. Es herrschte die Regel: "Wo kein Kläger, da kein Richter." Dieser Grundsatz beruht wahrscheinlich auf Ldr. I, 62, § 1 des Sachsenspiegels und bedeutete, dass dem Richter untersagt war, einen Prozess "ex officio" einzuleiten. Damit sollte verhindert werden, dass der Richter sich durch erzwungene Prozesse zusätzlich eine Einnahmemöglichkeit verschaffen konnte, indem er sich durch Bußen (und "Straffgelt") - dazu später - hätte bereichern können.
Mit der Entwicklung des Strafverfahrens als eigenständiges Verfahren neben dem Zivilverfahren hat dieser Grundsatz, der auch als Dispositionsmaxime bezeichnet wird, heute nur noch im Zivilprozess Bestand und bezeichnet die Verfügungsgewalt der Parteien über den Streitgegenstand (Beginn, Fortgang und Ende des Verfahrens). Hinsichtlich des Strafverfahrens besagt der Grundsatz "wo kein Kläger, da kein Richter" heute, dass niemand einer Strafe unterzogen wird, wenn die Strafverfolgungsbehörden von der begangenen Straftat keine Kenntnis erlangt haben.
Hinsichtlich der Bestrafung eines Menschen beinhaltet der Sachsenspiegel neben der Bestrafung durch Bußen Erscheinungsformen der peinlichen Strafe, also Leibes- und Lebensstrafen. Die traditionelle Bestrafung stellte zunächst nämlich das Bußenstrafrecht dar:
Die Bestrafung erfolgte hauptsächlich durch Bußgelder; den materiellen Ersatz für einen Menschen bezeichnete man als Wergeld bzw. Manngeld. Die Höhe der einzelnen Buße war sowohl von der sozialen Stellung des Opfers als auch der Art des Deliktes abhängig. Die Bußen und Wergelder stellten einen materiellen Schadensausgleich für den Verlust des Menschen dar.
Das Hochmittelalter ist nunmehr durch eine besondere Friedensbewegung gekennzeichnet, deren besondere Wirkung in der Kriminalisierung des Strafrechts liegt. Das bedeutete, dass das Delikt nicht mehr als Eingriff in die Rechte eines anderen betrachtet wurde, welcher mit Buße gesühnt wird, sondern als Friedensbruch, dessen Vergeltung nur durch peinliche Strafe, d. h. Leibes -und Lebensstrafen erfolgen konnte. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass entscheidend zunächst der Gottesfrieden war mit der Folge, dass demjenigen, der diesen Frieden brach, zunächst der Kirchenbann und die damit zusammenhängende Vermögenseinziehung angedroht wurde. Die herkömmliche Bußzahlung war verboten.
Daneben sind immer häufiger Leibes- und Lebensstrafen verhängt worden. Damit kann der früheren Theorie, die Kriminalisierung der Unrechtstaten habe erst mit den sog. königlichen Frieden eingesetzt, entgegengetreten werden. Mit den königlichen Frieden wurden jedoch die einzelnen Delikte mit differenzierten Straffolgen versehen, während die Gottesfrieden in den mit der Fehde typischerweise verbundenen Delikten (Brandstiftung, Raub, Heimsuchung, Tötung, Verletzung und Notzucht) verschiedene Begehungsformen des Friedensbruchs sahen.
Das Besondere an dem Sachsenspiegel ist nunmehr, dass er die Friedenssatzung, die zeitlich und räumlich begrenzt war (Ldr. II, 66) von dem dauerhaft geltenden peinlichen Strafrecht (Ldr. II, 13) trennte.
Diese Art der Bestrafung stellte im frühen 13. Jahrhundert jedoch noch die Ausnahme zu dem Bußenstrafrecht dar. Lediglich für schwere Delikte wurden Strafen an Leib und Leben verhängt. Folgende Delikte waren mit der Todesstrafe bedroht:
Diebstahl, der über einen Umfang von drei Schillingen hinausging, Raubmord, Friedensbruch, Ehebruch, Vergewaltigung, Zauberei, Giftmischerei.
Wie bereits oben erwähnt, gab es die Trennung zwischen Straf- und Zivilverfahren, so wie man es heute kennt, noch nicht. Im Sachsenspiegel sind einige Klagen aufgeführt, die sich nicht im Klagegrund, sondern in der Art eines bestimmten Beweisverfahrens und in dem bezweckten Erfolg unterschieden haben.
Dabei gab es zunächst die Klage um Ungerichte, die sich auf schwere Missetaten bezogen hat. Desweiteren gab es die Klagen um Erbe, Gut und Schuld sowie die Klagen um Eigen und Lehen. Es gab die Kampfklage sowie die Klagen "um al andere Sake" (Ldr. II, 3, § 3).
Besonders erwähnenswert waren die Klage mit dem Gerüfte und die Anfangsklage. Diese gehörten einem Verfahren an, dass wohl nach heutigen Kriterien dem Strafverfahren zuzuordnen ist.
Zunächst die Klage mit dem Gerüfte: Sie war für die Ergreifung des Täters bei der Tat oder auf seiner Flucht vorgesehen. Derjenige, der einen Täter auf frischer Tat überrascht, andere Personen, die sich in der Nähe befinden, mit dem Gerüfte, d. h. mit Geschrei, zu Hilfe ruft, den Täter festnimmt und gefesselt mit den Schreimannen vor Gericht bringt, hat die Klage mit dem Gerüft begonnen.
Die Anfangsklage bezog sich auf die Wiederinbesitznahme fahrender Habe (beweglicher Sachen) und beginnt zunächst damit, dass der Gegenstand (oder das Tier) von seinem eigentlichen Besitzer, der es nunmehr wiedergefunden hat, so angefasst wird, wie es rechtlich vorgeschrieben war. Mit diesem Anfassen und der Auforderung an den aktuellen Besitzer, mit dem Gegenstand zu Gericht mitzukommen, war der Anfangsprozess begonnen.
Beide Klagen wurden vor Gericht weitergeführt. Sofern der Täter auf handhafter Tat (frischer Tat) ergriffen wurde, war sofort Klage zu erheben. Unter handhafter Tat wurde eine Tat verstanden, bei deren Ausführung der Täter ertappt und ergriffen wurde und - meist durch das Gerüft - den anderen Personen bekannt wurde. Ein Handhafttäter war auch derjenige, der auf der Flucht von den Personen, die durch das Gerüft herbeigeeilt kamen, gestellt wurde. In diesem Fall mussten Gerüft, Verfolgung und Ergreifung des Täters unmittelbar nach der Tatausführung erfolgen.
Möglich war auch die Tötung des auf frischer Tat Ertappten, der Sachsenspiegel sah dies jedoch nur noch für den handhaften Ehebrecher vor.
Die Klage im Fall der handhaften Tat wurde mit dem Gerüfte am Tatort eingeleitet und später bei Gericht fortgeführt. Der Täter hatte dabei gefesselt vor das Gericht gebracht zu werden. Sofern der ordentliche Richter nicht oder nur schwer erreichbar gewesen ist, konnte ein Notgericht eingerichtet werden, das sich am Tatort befand. Das gestohlene Gut oder die bei dem Täter gefundene Waffe wurden an den Täter angebunden Dieser nunmehr gebundene Handhafttäter war vor Gericht sowohl tatsächlich als auch rechtlich wehrlos. Das Verfahren, das gegen ihn lief, war rein exekutorisch. Der Täter war reines Objekt des Verfahrens.
Lediglich der Verletzte oder derjenige, der ihn vor Gericht gebracht hat, wurde gehört. Er hatte die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Bindung wegen handhafter Tat zu beweisen und zwar durch Überführungseid. Der Kläger hat den Täter mit Hilfe der Eideshelfer übersiebnen können. Dazu brauchte der Kläger sieben Gewährsleute, die das Begehren des Klägers vor Gericht beeidigten. Der Täter hatte keine Möglichkeit, insbesondere konnte er nicht auf den Reinigungseid zurückgreifen. Dieses Handhaftverfahren sollte zu einer peinlichen Bestrafung des Täters führen. Dies ergibt sich aus zahlreichen Schöffensprüchen aus dem 14. und 15. Jahrhundert.
Der Überführungseid des Handhaftverfahrens kann als Ausgangspunkt für das materielle Beweisrecht angesehen werden. Der Kläger galt als näher zum Beweis; die Schreimannen, die durch das Gerüft mit zu Gericht gekommen sind, fungierten als Wahrnehmungszeugen, die durch ihren Eid den Nachweis der offenkundigen Rechtsverletzung erbrachten. Die Tatsache, dass gegen den Überführungseid der Reinigungseid nicht zugelassen war, ergibt sich daraus, dass die Handhaftigkeit in das Gericht verlegt wurde; eine Widerlegung des Augenscheins sollte nicht möglich sein.
Sofern der Täter auf handhafter Tat erschlagen wurde, wurde er zu Gericht gebracht und durch den Eid des Klägers überführt, um die die Tötung als rechtmäßig zu erweisen. Dies wird als Klage gegen den toten Mann bezeichnet.
Demgegenüber bezeichnet man als Klage mit dem toten Mann den Fall, in dem der Leichnam des Opfers vor Gericht gebracht wird, so dass der Tote gewissermaßen die Totschlagsklage erhebt. Die Leiche wurde als deutliches Zeichen des Rechtsbruchs vor Gericht gebracht.
Sofern das Handhaftverfahren nicht vorlag, konnte sich der geflohene Täter mit dem sog. Reinigungseid befreien. Dazu mußte er später freiwillig vor das Gericht treten. Der Eid wurde dem Schwörenden zunächst von einem Staber - ursprünglich war es wohl der Gegner des Beweisführers - vorgesagt und dann von dem Schwörenden Wort für Wort unter Berührung des Stabes und unter Anrufung Gottes wiederholt.
Die Möglichkeit des Reinigungseides bestand nicht, wenn der Kläger den Beklagten zum gerichtlichen Zweikampf aufforderte. Zu diesem Zweck mußte der Kläger die Kampfklage erheben. Es war auch möglich, dass jede Partei einen berufsmäßigen Kämpfer beauftragte. Derjenige, der obsiegte, hat für seine Partei den Beweisvorteil gesichert.
Der Zweikampf war ein Teil der noch im Sachsenspiegel herrschenden Gottesurteile, die mit dem Eid eng verwandt waren. Der Sachsenspiegel kannte desweiteren den Kesselfang und das Tragen des glühenden Eisens. Zum ersteren musste der Beklagte in einen Kessel mit kochendem Wasser fassen, zum zweiten musste er ein glühendes Eisenstück in die Hand nehmen. An der Hautveränderung wollte man glauben zu erkennen, ob der Täter die Wahrheit sprach.
Wie bereits oben erwähnt, war die peinliche Strafe nur bei besonders schwerwiegenden Delikten, beim sog. Ungerichte, oder aufgrund einer Festnahme des Täters auf frischer Tat möglich. Nach einem Leipziger Schöffenspruch aus dem 14. Jahrhundert wurde klargestellt, dass es sich bei den o. g. Delikten um die des Mordes, des Raubes, der Brandstiftung, des Diebstahls, der Vergewaltigung und Hurerei handelte. Bei vorsätzlicher und arglistiger Begehung dieser Delikte war die Todesstrafe die einzige Rechtsfolge. Bei Fehlen der Arglist und des Vorsatzes konnte eine Verbüßung vor Gericht in Betracht kommen.
Weniger schwerwiegende Delikte sollten sowohl mit der peinlichen Strafe als auch mit der vertraglichen Einigung geklagt werden. Im Falle der peinlichen Strafe wurde eine Hand abgeschlagen, die vertragliche Einigung führte zu einer Geldbuße. Der Diebstahl stand ab einer bestimmten Wertgrenze generell unter peinlicher Bestrafung (Erhängen). Diese Bestrafung konnte bei nicht handhafter Tat allerdings gegen Zahlung einer Geldbuße abgelöst werden. Es bestand auch die Möglichkeit, bei handhafter Tat eine Bestrafung an Haut und Haar vorzunehmen.
Der Sachsenspiegel kennt desweiteren folgende Bestrafungen: Verbrennung, Enthauptung, Verstümmelung. Als besonders unehrenhafte Strafen galten das Scheren der Haare, das Prangerstehen und die Prügelstrafe (Ausstäupen).
Manche Strafen können als "spiegelnde Strafen" bezeichnet werden; der Täter verliert das Glied, mit dem er das Delikt verwirklicht hat.
Als besonders grausame Strafe empfinde ich das Scheren der Haare, da nicht immer eine Schere benutzt wurde, sondern das Haar "mit eime cloven", d. h. einem gespaltenen Stock aus dem Kopf gewunden wurde.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es verschiedene Klagemöglichkeiten gab, die zunächst ohne weitere Abgrenzung nebeneinanderstanden. Dies erfuhr nunmehr eine Änderung, als versucht wurde, den Sachsenspiegel durch Glossierung mit dem römischen Recht und dem kanonischen Recht in Verbindung zu bringen. In diesem Zusammenhang ist nochmals Johann von Buch zu nennen, der in seinem verfassten Richtsteig Landrecht drei Hauptarten von Klagen benannt hat, nämlich die peinliche, die bürgerliche und die gemischte Klage. Unterscheidungskriterien liegen in den Verfahren selbst bzw. den Überführungs- und Verteidigungsmöglichkeiten der Beteiligten.
Die peinliche Klage richtet sich auf ausschließliche peinliche Bestrafung, also solche an Leib und Leben.
Die bürgerliche Klage umfasste die Klage auf Wergeld wegen Totschlags und Buße wegen leichter Körperverletzung.
Die gemischte Klage lag vor, wenn der Beklagte zwar wegen einer peinlichen Klage vor Gericht erschien, aber vor dieser die Bereitschaft zur Buße erklärte. Der Beklagte wurde also mit der gemischten Klage wegen geringerer Verletzungen verfolgt.
Dies zeigt das Charakteristische an dem Verfahrensrecht des Sachsenspiegels, welches darin lag, dass der Wille des Betroffenen ausschlaggebend war, ob die Tat des Beklagten nun unter peinlichen oder bürgerlichen Gesichtspunkten verfolgt wurde.
Hinsichtlich des mündlichen Vortrags war der Prozess sehr formalisiert. Man lief Gefahr, durch Versprechen oder Stottern den Prozess zu verlieren. Die Betroffenen nahmen sich daher Vorsprecher oder Fürsprecher, die geübt waren, gerichtsrelevante Tatsachen vorzutragen. Der Fürsprecher ersetzte nicht den Anwalt, der im übrigen selbst häufig durch Fürsprecher sprach; vielmehr war der Fürsprecher Vertreter im Wort. Selbst Zeugen sagten häufig durch Fürsprecher auf. Frauen kamen als Fürsprecher nicht in Betracht.
Durch den Strafausspruch und seine Vollstreckung wurde der Schuldige in seinen Rechten, z. B. auf körperliche Unversehrtheit bei den peinlichen Strafen und bei den Gefängnisstrafen in der Bewegungsfreiheit tangiert. Da es im Mittelalter noch keinen Polizeiapparat gab, war zum einen nie sicher, ob der Angeklagte bei Gericht erscheinen würde, zum anderen ob die Exekution des Urteils auch durchführbar ist. Aus diesem Grund wurde versucht, mittels einer Rechtloserklärung (Acht) den Strafvollzug durch die Achtfolgen zu ersetzen oder den Täter zum Erscheinen vor Gericht zu zwingen, der damit den Folgen der Acht entgehen konnte. Das Gericht hat mit der Ächtung die gesamte Rechtsgemeinschaft um Hilfe gebeten, den Täter zu stellen oder unschädlich zu machen. Je mehr sich das Gerichtswesen gefestigt hat, um so mehr ging die Verhängung der Acht zurück.
Achtgründe sind demnach zum einen Ladungsungehorsam oder Urteilsungehorsam in den Fällen, in denen wegen eines schweren Delikts Klage erhoben wurde. Die Acht ist verbunden mit der sog. Verfestung. Dort, wo der Sachsenspiegel von Verfestung spricht, meint er eine örtlich begrenzte Acht, die nur in dem Bezirk des Gerichts, von dem sie verhängt wurde, Geltung hat. Die Acht ist nach der Auffassung des Sachsenspiegels die Verfestung, die vom König ausgeht und deren Wirkung sich auf das ganze Reich ausdehnt. Ansonsten sind die Folgen dieselben wie bei der Verfestung, d. h. der Verfestete darf nicht klagen, nicht Zeuge oder Fürsprecher sein. Er darf nirgends zu Hause aufgenommen werden; ihm darf weder Speise noch Trank angeboten werden. Der Verfestete darf sich aber dem Gericht freiwillig stellen und für ein Gerichtsverfahren zur Verfügung stehen. Wenn er dies nicht tut, und ergriffen und nunmehr gefangen vor Gericht gebracht wird, wird in jedem Fall - unabhängig von seinem Vergehen - die Todesstrafe verhängt.
Eine Lösung aus der Acht ist auch möglich, nämlich dann, wenn der Täter sich gerichtlich oder außergerichtlich mit dem Opfer sühnt und zudem Friedensgeld zahlt. Mitunter hat auch das Versprechen gereicht, sich dem Gericht zu stellen. Über den, der Jahr und Tag in der Acht war, wird die sog. Oberacht verhängt. Damit wird der Betroffene rechtlos und verliert sein Lehen und sein Grundeigentum. Zudem wird seine Ehe aufgelöst. Eine rechtsfömliche Lösung aus der Oberacht ist nicht vorgesehen. Viemehr hat der Betroffene nur die Möglichkeit, sein Gut wiederzuerlangen, indem er einen ritterlichen Zweikampf ausficht.
Soviel zunächst zum Thema Strafverfahren und Strafrecht, das derart umfangreich ist, dass es eines eigenen Aufsatzes bedarf, um es detaillierter zu erfassen.
Literaturverzeichnis
1. Heiner Lück, Über den Sachsenspiegel,
Verlag Janos Stekovics, Dößel (Saalkreis) 2005
2. Walter Koschorrek, Der Sachsenspiegel in Bildern,
Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1976
3. Paul Kaller, Der Sachsenspiegel – In hochdeutscher Übersetzung,
Verlag C. H. Beck, München 2002
4. Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte Band 1,
Westdeutscher Verlag, 11. Auflage, Opladen/Wiesbaden 1999
5. A. Erler/E. Kaufmann (Hrsg.), Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte,
Erich Schmidt Verlag, Berlin 1971/1978
Zitierhinweis
Die Rechtsfundstellen sind wie folgt zitiert:
Ldr. I, 62, § 1 = Landrecht 1. Buch, Abschnitt 62, Paragraf 1